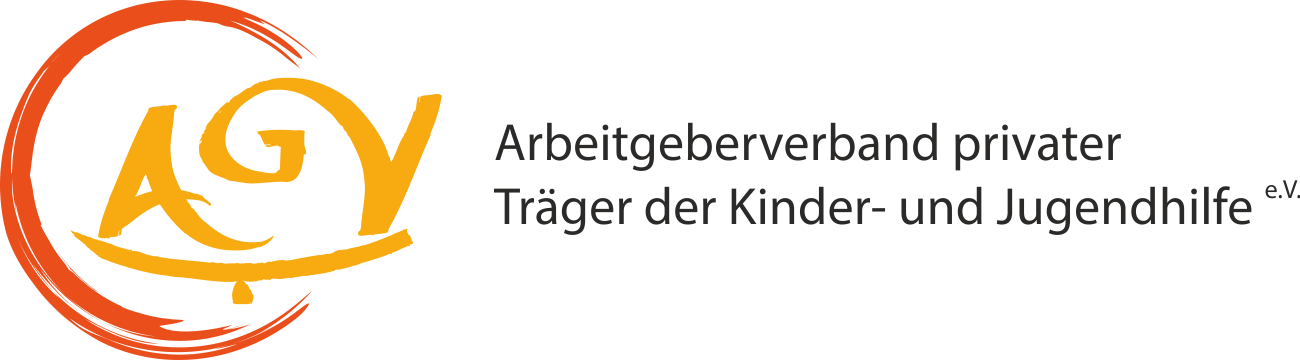Gestern, am 28.01.2026, hat das Bundeskabinett die "Nationale Tourismusstrategie" beschlossen. Was sich zunächst so gar nicht danach anhört, dass das Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft haben könnte, entpuppt sich beim näheren Lesen (auch) als relevant für ausgesprochen viele Wirtschaftsbereiche, und vor allem auch die Kinder- und Jugendhilfe.
Das Strategiepapier enthält im letzten Abschnitt Vorschläge, die der Gewinnung qualifizierter Arbeitskräfte dienen sollen sowie zur Gestaltung zeitgemäßer Arbeitsbedingungen.
Zwei Punkte sind dabei von großer Bedeutung:
1. Die Bundesregierung will im Einklang mit der europäischen Arbeitszeitrichtlinie die Möglichkeit einer wöchentlichen anstatt einer täglichen Höchstarbeitszeit schaffen – auch und gerade im Sinne
einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
2. Als Anreiz wird der Bund Überstundenzuschläge steuerfrei stellen und einmalig gezahlte Prämien zur Ausweitung der Arbeitszeit bei Teilzeit steuerlich begünstigen. Mit der „Aktivrente“ stellt die
Bundesregierung seit 1. Januar 2026 älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, welche über das gesetzliche Renteneintrittsalter hinaus weiterarbeiten möchten, bis zu 2.000 Euro ihrer Einkünfte steuerfrei.
Während der zweite Punkt voraussichtlich für alle Branchen übergreifend geregelt wird, steht bei der Flexibilisierung der Arvbeitszeiten woghl noch nicht fest, ob es dazu eine Tariföffnungsklausel geben wird. Unabhängig davon wird die Flexibilisierung nur die maximal zulässige Wochenarbeitszeit betreffen und nicht etwa die ausgleichsfreie Verlängerung der Arbeitszeit, wie sie i.d.R. in EInrichtungen der Kinder- und JUgendhilfe genutzt wird. Letztere bleibt den Tarifvertragsparteien vorbehalten.
29.01.2026 MdC